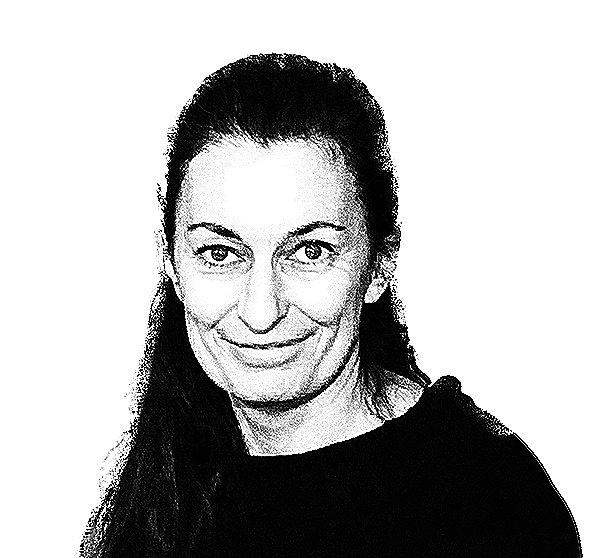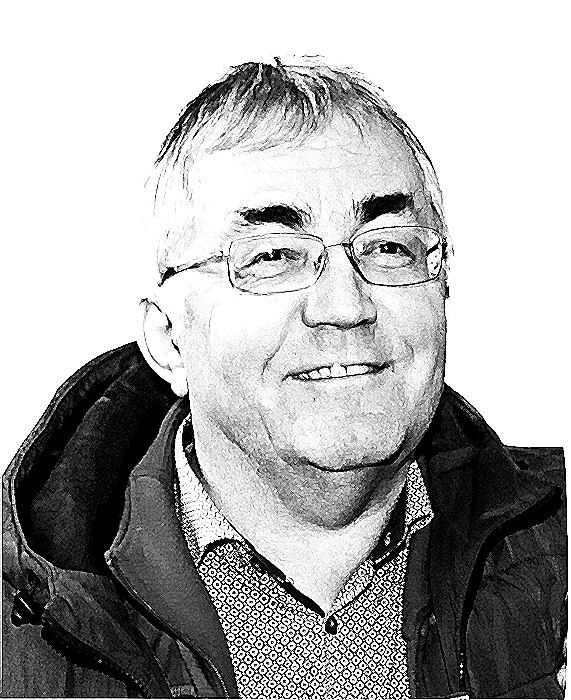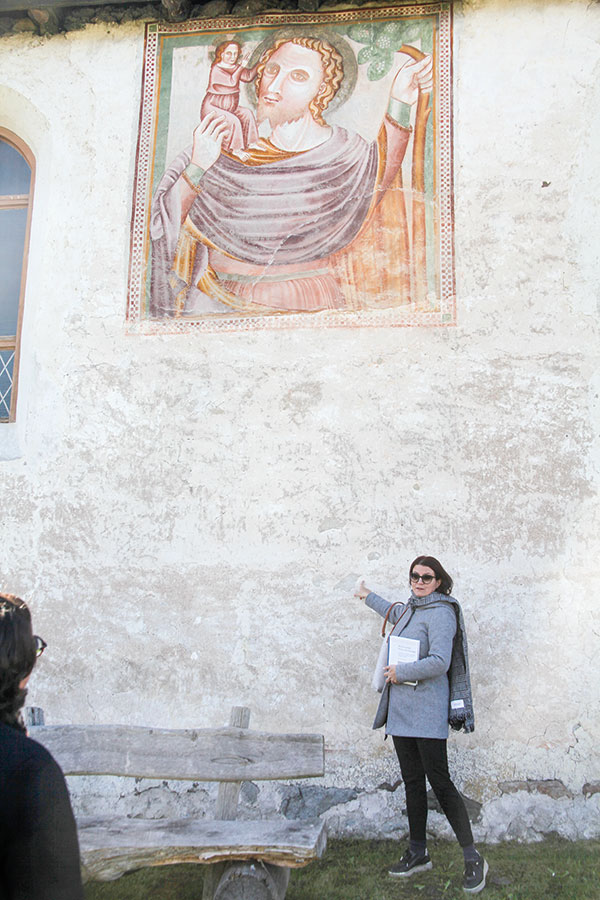Die Schule, insbesondere die Lehrerschaft, ist letzthin in aller Munde. Auch im Vinschgau. Inklusion, technologischer Fortschritt, gesellschaftliche Umbrüche – wie der Rest der Gesellschaft auch, ist vor allem die Schule ein Ort des ständigen und immer schneller werdenden Wandels. Der Vinschgerwind hat zum Thema Schule, insbesondere ob ihrer Ansichten zu den Protesten der Lehrpersonen, die Direktorin der Mittelschule Prad Sonja Saurer befragt.
Vinschgerwind: Frau Saurer, was sagen sie als Direktorin zu den aktuellen Forderungen wohl auch ihrer Lehrpersonen?
Sonja Saurer: Als Schuldirektorin stehe ich voll und ganz hinter den berechtigten Forderungen meiner Lehrpersonen. Die engagierte Arbeit unserer Lehrerinnen und Lehrer ist von unschätzbarem Wert für die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Dass sie nun gemeinsam für angemessene Lohnerhöhungen eintreten, ist nachvollziehbar und verdient Respekt. Es ist wichtig, dass die Verantwortungsträger die Anliegen ernst nehmen und Lösungen finden, die den Kolleginnen und Kollegen Anerkennung und faire Bedingungen bieten. Nur so können wir die Qualität unseres Bildungssystems sichern und motivierte Lehrpersonen langfristig halten.
Vinschgerwind: Wie bewerten sie die Protestmaßnahme der Lehrerschaft an keinen Ausflügen teilzunehmen?
Sonja Saurer: Ich sehe die Entscheidung vieler Lehrpersonen, derzeit keine Ausflüge oder außerschulischen Aktivitäten durchzuführen, als eine Form des stillen, aber sehr deutlichen Protests. Es handelt sich dabei um eine der wenigen Möglichkeiten, um auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen – insbesondere im Hinblick auf die ausbleibenden Lohnerhöhungen, aber auch angesichts der gestiegenen Komplexität im Berufsalltag.
Wichtig ist mir zu betonen: Dieses Zeichen des Protests richtet sich nicht gegen die Schülerinnen und Schüler. Im Gegenteil – den Lehrpersonen geht es darum, Versprochenes einzufordern, und dafür ein Zeichen zu setzen, das sichtbar ist, ohne den Unterricht direkt zu beeinträchtigen. Natürlich bedaure ich es, wenn Protestmaßnahmen zu radikal werden oder in Einzelfällen überzogen wirken. Andererseits wurde auch bei uns in der Vergangenheit – teils auch aus gesellschaftlichem Druck – ein regelrechter „Ausflugstourismus“ betrieben, der manchmal den eigentlichen pädagogischen Auftrag aus dem Blick verloren hat. Auch das gehört zur Diskussion: Was erwarten wir von Schule, und was wird ihr alles aufgebürdet? Immer mehr Aufgaben, die früher im sozialen Umfeld oder in der Familie verankert waren, werden heute selbstverständlich an die Schule delegiert.
Insofern sehe ich in der aktuellen Situation auch einen Anstoß zur grundsätzlichen Reflexion über die Rolle von Schule, über Wertschätzung von Bildungsarbeit und über die politische Verantwortung, die damit einhergeht. Denn was mich besonders nachdenklich stimmt, ist, dass sich im Zuge dieser Diskussionen auch eine tiefere gesellschaftliche Entwicklung spiegelt: die Tendenz, immer mehr Verantwortung an die Gemeinschaft, an den Sozialstaat oder eben an die Schule zu delegieren. Es wird nicht mehr gefragt, was kann der Einzelne für die Gemeinschaft tun, sondern was kann die Gemeinschaft für den Einzelnen tun. Ich denke, es wäre an der Zeit diese Entwicklung umzukehren, wir haben gemeinsame Aufgaben zu bewältigen, der Einzelne sollte sich zurücknehmen zum Wohle der Gemeinschaft.
Vinschgerwind: An vielen Schulen fehlt Personal – wie spüren Sie den Lehrermangel bei Ihnen in Prad?
Sonja Saurer: In einigen Wettbewerbsklassen fehlen seit Jahren Lehrpersonen: Italienisch, Religion und Mathematik/Naturkunde. Ausnahmsweise besser ist heuer die Situation in den Grundschulen: Entgegen der Pressemitteilungen habe ich gerade heuer -nach 15 Jahren in der Schulführung – noch nie so viele Lehrpersonen mit gültigem Studientitel bzw. mit fast abgeschlossenem Studium beauftragen können.
Vinschgerwind: Wie gelingt es Ihrer Schule, Kinder mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen gut einzubinden?
Sonja Saurer: Es gelingt immer dann, wenn alle Erwachsenen, auch die Eltern, die Bildungsarbeit der Schule mittragen und unterstützen: Bildung als wichtig erachten, ihr Kind beim Lernen begleiten, mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten, präsent sind, selbst die Sprache der Schule lernen und als Vorbilder gemeinsam mit ihren Kindern den Bildungsweg gehen.
Vinschgerwind: Wenn Sie ehrlich sind: Was bereitet Ihnen als Direktorin derzeit die größten Kopfschmerzen?
Sonja Saurer: Was mir derzeit am meisten Sorgen bereitet, sind nicht nur die strukturellen Herausforderungen in der Schule, sondern auch tiefere gesellschaftliche Entwicklungen rund um Kindheit und Erziehung. Viele Eltern stehen unter dem ständigen Druck, alles perfekt zu managen: Karriere, Familie, Partnerschaft – am besten in einer durchgetakteten, digital optimierten Welt. Dieses Streben nach Perfektion überträgt sich oft auf die Kinder. Auch ihr Lernen soll heute möglichst schnell, reibungslos und ohne Übergangsphasen funktionieren – als wäre Entwicklung ein planbarer Prozess ohne Umwege oder Pausen.
Ich sehe Kinder, die mit gesenktem Blick im Buggy sitzen – gebannt auf ein Handy starrend, während sie von ebenso abgelenkten Erwachsenen durch die Gegend geschoben werden. Ein Sinnbild für eine Kindheit, in der echte Begegnung, Präsenz und Dialog zunehmend verloren gehen. Die Digitalisierung ersetzt dabei nicht nur Aufmerksamkeit, sondern vermittelt auch früh das Gefühl, dass alles immer sofort verfügbar und abrufbar sein muss – auch Bildung.
Eltern treten heute mit großen Erwartungen an die Schule heran – häufig verständlich im Bemühen, Familie und Beruf gut zu vereinbaren. Doch nicht alles, was „familienfreundlich“ wirkt, ist automatisch auch kinderfreundlich. Der Fokus liegt oft auf Effizienz: Lernen soll perfekt funktionieren, in den Alltag passen und möglichst keine Reibung erzeugen. Dabei wird vergessen, dass Kinder Zeit brauchen – für Entwicklung, für Fehler, für echtes Verstehen. Schule ist kein Dienstleistungsbetrieb, sondern ein pädagogischer Raum mit eigenen Anforderungen. Auch die aktuellen Protestformen von Lehrkräften sind kein Angriff auf Kinder, sondern ein Weckruf. Sie machen aufmerksam auf strukturelle Überlastung, auf mangelnde gesellschaftliche Anerkennung und auf die zunehmende Delegation erzieherischer Verantwortung an die Schule. Bildung ist nicht zum Nulltarif zu haben – weder menschlich noch finanziell.
Ich wünsche mir einen ehrlichen Diskurs darüber, was Kinder heute wirklich brauchen – und was Schule leisten kann, sie kann nicht alles kompensieren. Wir brauchen mehr als reibungslose Organisation: Wir brauchen Zeit, Vertrauen und Wertschätzung – für Kinder, für ihre Lernwege und für die Menschen, die sie dabei täglich begleiten.